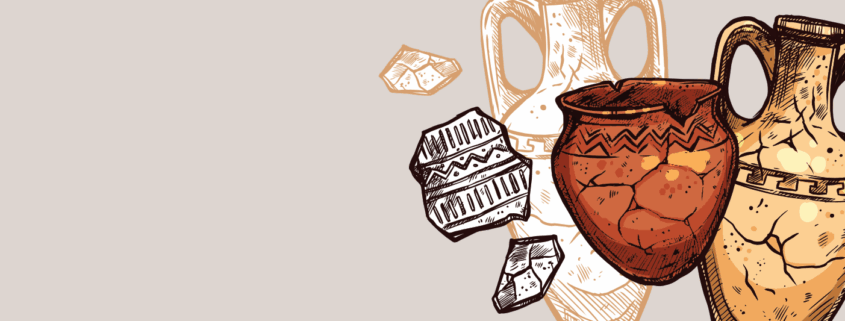
2.1 Von der Frühen Kirche bis zur Reformation
Ausgehend von den Schriften der frühen Kirchenväter wie z.B. Irenäus und Justin finden wir Ansätze und Spuren eines Katechumenats, also einer Vorbereitung auf die Taufe oder einer Glaubensunterweisung. Diese war jedoch vorwiegend auf Erwachsene aus den gehobenen Schichten beschränkt und ähnelte den zeitgenössischen Philosophenschulen1. Erst Ende des 4. Jhdt. formuliert Chrysostomus in seinem 393 n. Chr. erschienenen Hauptwerk „Über Hoffart und Kindererziehung“ einige relevante Gedanken über die christliche Kindererziehung. Auffallend ist jedoch, dass schon damals sein oberstes Erziehungsziel christozentrisch war. Er war der Auffassung, dass jeder Getaufte und auch jedes Kind zum Kämpfer für Christus werden solle, um so seiner Gottesebenbildlichkeit zu entsprechen2.
Augustinus beschäftigt sich etwa zur gleichen Zeit ebenfalls mit den Fragen nach einer gelingenden Katechese, also einer Unterweisung oder Einführung in die Glaubenspraxis. Er ist dabei überzeugt, dass Lehren und Lernen nur möglich sind, durch das Hören auf den eigentlichen Lehrer und Meister der Wahrheit, Jesus Christus. Nur er allein kann wahre Erkenntnis schenken. Schon damals berücksichtigt Augustinus gewisse Ansätze der Entwicklungspsychologie, indem er sich auf den Zuhörer besinnt und darauf achtet, welches Alter die Zuhörer haben, welche geistige Entwicklung sie haben, aus welcher Gesellschaftsschicht sie kommen, ob sie schüchtern und verschlossen sind und ob sie aufnahmefähig oder eher schwerfällig von Begriff sind. Ja selbst über die Beschaffenheit des Unterrichtsraumes macht er sich Gedanken. Bei ihm finden wir auch erste Ansätze eines heilsgeschichtlichen Konzeptes. Es besteht aus vier Teilen. Zuerst erfolgt ein Gang durch die Zeitalter der Heilsgeschichte (narratio). Darauf folgt die Erklärung unbekannter Ausdrücke und Themen (explicatio) worauf dann ein Gespräch mit dem Katechumenen (dem Schüler) folgte, dass ihn herausfordern sollte (interrogatio). Am Ende gab Augustinus noch sittliche Ermahnung zu einer evangeliumsgemäßen Lebensführung (exhortatio)3.
Durch die Erhebung des Christentums zur Staatsreligion veränderte sich in der Folge das Katechumenat radikal. Eine Glaubensunterweisung erfolgte immer mehr erst nach der Taufe und nicht mehr vor der Taufe. Bis zum Mittelalter finden wir wenig direkte Dokumente zu katechetischen Inhalten. Ein weiterer wesentlicher Faktor, der zum Verschwinden einer systematischen Glaubensunterweisung führte, war die Einführung der Kindertaufe. Erst im Mittelalter kam es, durch das Aufkommen von Klosterschulen, zu einem Aufstieg des städtischen Schulwesens, vor allem der Domschulen. Jedoch blieb die Unterweisung der Kinder hauptsächlich Aufgabe der Eltern und Großeltern, die stark durch die Gemeindepredigt geprägt war4.
2.2 Reformation bis zur Aufklärung
Bereits kurz vor der Reformation dachte Erasmus von Rotterdam darüber nach, wie religiöse Bildung gefördert werden kann. Er veröffentlichte 1512 sein katechetisches Werk in dem er von dem Grundsatz ausgeht, dass niemand als Christ geboren wird. Einer seiner Grundsätze war, dass die Lehre sich am Kind orientieren müsse5.
Bis zur Reformation gab es ein einheitliches Glauben und Denken. Die Priester sagten was zu Glauben war und das Volk richtete sich danach. So war eine persönliche Aneignung von theologischem Grundwissen überflüssig, denn es gab keine andere Lehrauffassungen mit denen man sich auseinandersetzen musste. Auch gab es keine Notwendigkeit für den einfachen Bürger, Lesen und Schreiben zu können, denn die Geistlichen sagten ihnen, wie man zu glauben hat. Diese wiederum hatten wenig Motivation, mehr als das für den Beruf unbedingt notwendige zu lernen6.
Durch seine reformatorischen Grundeinsichten: „Allein der Glaube, allein die Schrift, allein die Gnade und allein Jesus Christus“, löste Martin Luther eine große Bildungsoffensive aus. Jetzt war nicht mehr der Glaube der Priester maßgeblich, sondern der Glaube eines jeden einzelnen. Damit die Menschen jedoch ihren Glauben verstehen und begründen konnten, mussten die Menschen gebildet sein. Daher forderte Luther von den Ratsherren aller Städte, christliche Schulen einzurichten und die Kinder zur Schule zu schicken. Er und auch die weiteren Reformatoren waren sehr beunruhigt über das geringe biblische Wissen der Menschen und deshalb machte er sich zur Aufgabe die Kernpunkte des Glaubens in einer übersichtlichen, Lehr- und Lernbaren Form festzuhalten: den Katechismus. In der Folge kam es zu einer Vielzahl von Katechismusbildungen durch andere Reformatoren wie Calvin, Melanchthon und Petrus Canisius und zu Vorformen der Sonntagsschule.
Auch die Gegenreformation der Jesuiten und der Ursulinen bemühte sich insbesondere um die Unterweisung der Kinder durch Bildungs- und Erziehungseinrichtungen7. Karl Borromäus (1538-84) ein Bischof von Mailand führte in Italien ab 1565 einen sonntäglichen Christenlehrunterricht ein, der mit Schreib- und Leseunterricht für die armen Kinder verbunden war8.
2.3 Der Pietismus
Die religiöse Erneuerungsbewegung der Pietisten wandte sich, mitten in der Zeit der Aufklärung, gegen die reine Buchstabengläubigkeit und den Dogmatismus der evangelischen Kirche. Sie sah das Menschenbild von der Bibel her und lehrte das der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Die Erneuerung des Menschen geschieht allein durch den Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Diese Grundansichten führten dazu, dass der Pietismus die Erziehung der Kinder von Gott her begründete. Deshalb sind die Hauptinhalte der pietistischen Pädagogik, der Glaube an Gott und wie dieser sich im christlichen Lebenswandel zeigt. Wir betrachten im Folgenden auszugsweise drei große Pädagogen aus der Zeit des Pietismus, wobei wir lediglich ihr Wirken im pädagogischen Bereich berücksichtigen.
2.3.1 August Hermann Francke (1663 – 1727)
August Hermann Francke studierte Theologie und kam schließlich im Jahr 1692, auf Einladung Phillip Jakob Speners, den er von seiner Schrift „Pia desideria“ her kannte, nach Glaucha, einem Stadtteil von Halle. Hier sah er die katastrophalen Zustände der Erziehung und insbesondere der Armen und Waisen. So gründete er 1695 eine Armenschule und ein Waisenhaus. In den Jahren darauf folgte die Gründung einer Apotheke, einer Druckerei, einer Bibelanstalt, eines Krankenhauses und einer Hauptbibliothek. Alle diese Gründungen und Unternehmungen entstanden aus dem tiefen Verlangen Kindern und Jugendlichen in ihrer Not zu helfen und sie zum lebendigen Glauben an Christus zu führen. In seinem Hauptwerk: „Kurzer und einfältiger Unterricht wie die Kinder zur wahren Gottseligkeit und christlichen Klugheit anzuführen sind“ beschreibt er, ausgehend von seinem biblischen Menschenbild, das Ziel seiner Erziehung wie folgt: „Der Haupt-Zweck muß die Ehre Gottes seyn, sowohl bey den Kindern, als auch bey dem Praeceptore.“9 Alles sollte der Ehre Gottes dienen. Die größte Ehre Gottes ist es, wenn der Mensch wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurückgeführt wird und als Christ in dieser Welt leben lernt. Dieses Ziel wurde von allen Lehrern als das höchste anerkannt und auch die Eltern, die ihre Kinder in Frankes Schulen schickten, mussten es akzeptieren. Jedoch war er sich bewusst, dass er niemanden zum Christen erziehen könne, sondern seine Methoden nur dazu dienen, den Kindern den Weg zu diesem Ziel zu zeigen und ihnen Hilfestellung zu geben, diesen Weg auch zu gehen. Im letzten ist es Gott, der in den Kindern den Glauben wirkt.10
2.2.3.2 Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700 – 1760)
Nikolaus Ludwig wurde von seiner Mutter großgezogen, da sein Vater schon kurz nach seiner Geburt starb. Sie war stark vom Pietismus geprägt und so besuchte er das Pädagogikum Franckes in Halle und wurde maßgeblich dadurch geprägt. Auch er begann sich, aufgrund seiner Erfahrung in Franckes Anstalt, mit der Erziehung von Kindern auseinander zu setzen. Das vorrangige Ziel seiner Erziehungsanstalt war der Aufbau und die Erhaltung der Beziehung zu Jesus. Für seine Pädagogen hatte er eine wichtige Grundvoraussetzung. Alle Erzieher mussten eine intensive Beziehung zum „Heiland“ haben und einen beständigen Umgang mit dem „Schmerzensmann“.
Die Hauptaspekte seines pädagogischen Konzepts sind, Liebe, Vertrauen sowie das positive Beispiel des Pädagogen, welches in den Kindern die Freude, ein christliches Leben führen zu wollen, wecken sollte. In verschiedenen, geschlechtergetrennten Reden an die Kinder, geht er konkret auf geschlechts- und altersspezifische Probleme der Kinder ein. Sein ganzes Leben spiegelte seine religionspädagogische Praxis wider.11
2.2.3.3 Johann Friedrich Flattich (1713 – 1797)
Johann wurde als Sohn eines Dorfschullehrers geboren, von dem er seine Leidenschaft für die Pädagogik erbte. Als Johann 15 Jahre alt war, starb sein Vater und nur ein Jahr später wird Johann Schüler des berühmten Theologen Johann Albrecht Bengel. Nach dem Abschluss seines Theologiestudiums und verschiedener Lehrtätigkeiten an verschiedenen Pfarrstellen, wird er schließlich im
Jahr 1760 Pfarrer in Münchingen bei Korntal. Hier baut er eine private Schule für Verhaltensauffällige junge Menschen und Waisen, die einen tiefen Eindruck auf die gesamte Ortschaft, Umgebung und den Pietismus hat. Seine pädagogischen Grundgedanken lauten: Viel Liebe. Viel Geduld. Viel Gebet. Außerdem legt er großen Wert auf Fleiß, Denkschulung, Selbsttätigkeit und Gottes Wort verbunden mit Lebenserfahrung. Für Flattich war die Erziehung, die Hauptaufgabe der Familie und nicht des Staates. Er galt als ein begnadeter Erzieher, mit einem großen erzieherischen Talent und einer großen Naturverbundenheit, die sich in seinen Predigten und Erziehungsgrundsätzen niederschlug und in denen er viele neue, erzieherische Wege ging.
Auch Flattich war von einem zutiefst biblisch-realistischen Menschenbild geprägt.12
„Er ging aus von den Grundgedanken: der Mensch ist von Gott geschaffen und deshalb sehr wertvoll. Das gilt gerade auch für das Kind. Respektvoller und liebevoller Umgang mit dem Kind ist deshalb angebracht. Die natürlichen Gaben Gottes dürfen nicht verachtet werden. Jedoch ist der Mensch in Sünde gefallen und in allerlei Bindungen versklavt. Er benötigt deshalb Führung und Wort Gottes. Durch die Erlösungstat Christi ist der Weg frei, heraus aus Sklaverei und Sünde. Diese Botschaft muss dem Kind gezeigt und vorgelebt werden. Durch liebevolles begleiten sollen die Kinder Verständnis für Vergebung, Versöhnung und Heilung gewinnen. Bei aller Erziehung ging es Flattich immer um den Kern des Evangeliums, um Jesus Christus selbst.“
Sein gesamtes Erziehungskonzept ging vom Evangelium aus. Ihm ging es darum den Willen Gottes zu erkennen und den Geboten Gottes zu gehorchen, jedoch ausschließlich über den Weg des Neuen Testaments, nämlich über Jesus Christus selbst. Hieran erkennt das Kind die Liebe Gottes zu ihm und wird deshalb innerlich angetrieben, Gott zu lieben und ihm zu gehorchen13.
2.4 Von der Aufklärung bis heute
In den Jahren vor 1780 beschäftigte sich Robert Raikes, ein Zeitungsverleger aus der britischen Stadt Gloucester mit den katastrophalen Zuständen der armen Kinder, die während der Woche arbeiten mussten und sich am Sonntag die Zeit mit Glücksspielen und kleinen Gaunereien und gottlosen Redensarten vertrieben. Er war entsetzt über die Redensarten, der herumlungernden Kinder und startete schließlich im Juli 1780 die erste „Sunday School“ im Haus einer Witwe. Sein Ziel war es den Kindern Lesen und Schreiben anhand der Bibel beizubringen, um sie somit mit dem Evangelium bekannt zu machen14. Schon wenige Jahre später war seine Sonntagschule soweit bekannt, dass immer mehr Sonntagschulen in England entstanden. Er gilt somit als Begründer der Sonntagschule15.
Pastor Johann Wilhelm Rautenberg, ein Pfarrer aus dem Hamburger Stadtviertel St. Georg gründete am 9. Januar 1825 zusammen mit Johann Gerhard Oncken, der das Elend der Arbeiterkinder sah, die erste Sonntagschule in Deutschland mit englischem Vorbild. Oncken schrieb am selben Tag in sein Tagebuch: „Die erste Sonntagsschule in Hamburg gegründet, d. 9. Jan. 1825 von J.G. Oncken und Rautenberg …“. Die Hauptziele der Sonntagschule war die Bekämpfung des Analphabetismus unter den Armenkindern und ihnen eine christliche Erziehung zu geben. 1832 wurde Oncken von Johann Hinrich Wichern abgelöst16.
Die Kirche reagierte nur zögerlich auf diese Neuerscheinung. Erst 1887 plädierte, bahnbrechend der Oberhofprediger F. W. Dibelius auf dem Kongress für Innere Mission in Dresden für einen „Kindergottesdienst“ und prägte somit auch den Begriff des Kindergottesdienstes17.
In den folgenden Jahren stieg die Teilnehmerzahl der Kindergottesdienst stark an, sodass in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ein Höhepunkt des Kindergottesdienstes zu konstatieren ist. Etwa um 1925 feierten etwa 1,2 Millionen Kinder sonntäglich den Kindergottesdienst. Jegliche Versuche kinderpsychologische Gesichtspunkte für die Gestaltung des Kindergottesdienstes fruchtbar zu machen, setzten sich nicht durch. In der Zeit des Nationalsozialismus werden 1934 alle Nicht-kirchengemeindliche Aktivitäten der Kinder- und Jugendarbeit in die nazistische Jugendorganisation eingegliedert. Die Zahl der Kinder im Kindergottesdienst geht während dieser Zeit stark zurück, vor allem bei Kriegsbeginn.
Nach dem Ende des Krieges versuchte man den Kindergottesdienst mithilfe von Ansätzen aus den dreißiger Jahren wieder aufzunehmen. Diese haben jedoch als Anliegen, die Kinder zum Erwachsenengottesdienst hinzuführen und verfehlen ihr Ziel, die Kinder zu Jesus Christus zu führen. Es wurde unterschieden zwischen dem Kindergottesdienst, der auch von Laien durchgeführt werden kann und minderwertig ist, und dem Hauptgottesdienst der für die Erwachsenen gilt18.
Durch den starken Rückgang der Besucherzahlen, musste die Gestaltung des Kindergottesdienstes in den 70er Jahren neu überdacht werden. Der Kindergottesdienst in der Landeskirche entwickelte sich von dem Ziel der Integration in den sonntäglichen Gottesdienst der Erwachsenen hin zu einem thematisch-problemorientierten Unterricht. Mittlerweile verliert der Sonntag- Vormittag als die selbstverständliche Kindergottesdienstzeit in vielen Kirchen und Gemeinden seine Dominanz und man weicht auf alternative Tage und Uhrzeiten aus19.
- Georges, „Vom philosophischen Schulbetrieb zum kirchlichen Katechumenat“,
https://www.youtube.com/watch?v=qb7Ay-J-4RU ↩︎ - Boschki, Einführung in die Religionspädagogik, S. 25f. ↩︎
- A.a.O., S. 27f. ↩︎
- Boschki, a.A.O., S. 28. ↩︎
- Boschki, a.A.O., S. 29ff. ↩︎
- Schröter, Glauben-Lehren-Erziehen, S. 15f. ↩︎
- Boschki, ebd. ↩︎
- Thiel, W. „Sonntagsschule“, Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Sp. 144f. ↩︎
- Francke, Kurzer und Einfältiger Unterricht, S. 15. ↩︎
- Velten, Glauben-Lehren-Erziehen, S. 38ff. ↩︎
- A.a.O. S. 67ff. ↩︎
- Schaude, Otto „Johann Friedrich Flattich“, Glauben-Lehren-Erziehen, S. 99. ↩︎
- Schaude, a.A.O., S. 91ff. ↩︎
- Walters, Robert Raikes Founder of Sunday Schools, S. 30ff. ↩︎
- Thiel, W. RGG, Sp. 1281f. ↩︎
- Hamp, Volkmar und Brigitte Brandt, „Die Arbeit mit Kindern im Bund Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden in Deutschland“, Handbuch Arbeit mit Kindern, S. 463f. ↩︎ - Thiel, A.a.O. ↩︎
- Grethlein, Neues Gemeindepädagogisches Kompendium, S. 221f. ↩︎
- Grethlein, „Kindergottesdienst, evangelisch“, https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/200207/ ↩︎

